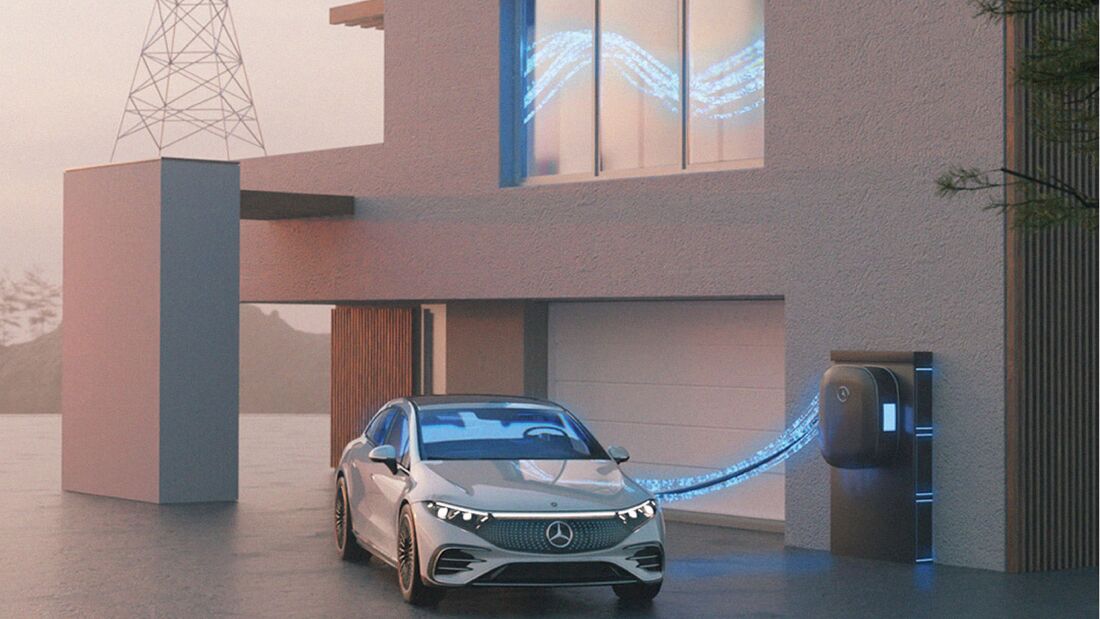Neue Regeln machen V2G ab 2026 wirtschaftlich
Der Bundestag hat eine zentrale Hürde für Vehicle-to-Grid (V2G) beseitigt: Ab 2026 wird rückgespeister Strom aus Elektrofahrzeugen nicht mehr doppelt mit Netzentgelten belastet. Damit wird das bislang ungehobene Speicherpotenzial von mehr als 1,65 Millionen E-Autos erstmals wirtschaftlich nutzbar – ein wichtiger Schritt für Netzstabilität, Energiewende und Flotten, die bereits heute hohe Elektroanteile fahren.
Gleichstellung mit Speichern schafft fairen Rechtsrahmen
Kern des Beschlusses ist die Gleichstellung von Fahrzeugbatterien mit stationären Speichern. Rückgespeister Strom wird künftig wie Speicherstrom behandelt und nicht mehr als zusätzlicher Verbrauch abgerechnet. Parallel vereinfacht die Bundesnetzagentur ab April 2026 mit der neuen MiSpeL-Regelung den technischen Prozess: V2G funktioniert dann ohne zweiten Stromzähler und ohne komplexe Abläufe. Netzbetreiber benötigen anschließend sechs bis zwölf Monate für die Umsetzung, sodass die Technologie ab 2026 schrittweise in den Markt wächst. Voraussetzung bleibt eine moderne Smart-Meter-Infrastruktur.
Dezentrale Speicherkapazität entlastet Stromnetz
Für die Energiewirtschaft bedeutet V2G ein beachtliches Flexibilitätspotenzial. Selbst bei konservativer Anschlussquote könnten E-Autos kurzfristig 1,0 bis 1,5 GW Leistung bereitstellen – die Größenordnung eines Großkraftwerks. Davon profitieren insbesondere Flottenbetreiber, die künftig überschüssige Energie intelligent puffern oder gezielt zurückspeisen könnten.
Technik ist bereit – Hersteller treiben Lösungen voran
Technisch ist V2G längst marktreif, wie Branchenbeispiele zeigen. The Mobility House verweist auf mehr als zehn Jahre Projekterfahrung und bereitet zusammen mit Partnern wie Mercedes-Benz End-to-End-Lösungen für 2026 vor. „Wir verwandeln das E-Auto vom Verbraucher zum verteilten Kraftwerk“, sagt Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House Energy. Für Unternehmen eröffnen sich neue Geschäftsmodelle rund um Flexibilität und Netzservices.
Ladeinfrastruktur wird zum aktiven Netzbaustein
Auch Ladeinfrastruktur-Hersteller begrüßen den Beschluss. Albina Iljasov, Europachefin des DC-Ladeanbieters XCharge, nennt die Entscheidung „längst überfällig“ und betont, dass die Technik für ein flexibles, digitales Stromnetz bereits vorhanden sei. Bidirektionale Schnelllader könnten Lastspitzen abfedern, Anschlusspunkte entlasten und Netzkapazitäten kostengünstiger bereitstellen als reiner Leitungsneubau. XCharge bietet dazu batterieintegrierte DC-Ladesäulen wie die GridLink, die V2G, lokale Energiespeicherung und PV-Anbindung unterstützen.
Neue Chancen für Flotten: Infrastruktur, Erlöse, Flexibilität
Für Fuhrparks ist der Beschluss ein Wendepunkt: Wo heute Ladeinfrastruktur oft nur Energie ins Fahrzeug bringt, könnte sie künftig aktiv zur Netzstabilität beitragen – und neue Erlösmöglichkeiten erschließen. Mit dem politischen Signal, vereinfachten Prozessen und wachsender technischer Verfügbarkeit entsteht erstmals ein Marktumfeld, in dem V2G vom Pilotprojekt in die Praxis übergehen kann.